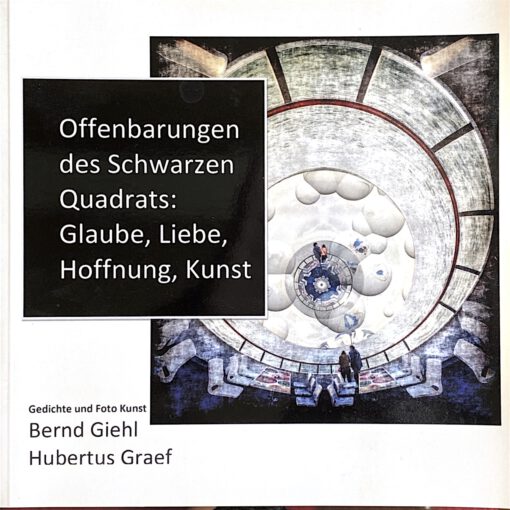Versuch über eine literarisch-theologische Figuri
von Bernd Giehl
„Mama, ist die Frau aber dick.“ Die kleine Ursula sagt das zu ihrer Mutter, als die Tante, die sie noch nie gesehen hat, die Familie besucht. Die Mutter ist peinlich berührt, aber die Tante lacht nur und sagt: „Kinder und Narren sagen die Wahrheit“.
Kinder und Narren. Diese Zusammenstellung sagt schon alles. Kinder nehmen sich Freiheiten, die sonst niemand für sich beanspruchen darf. Kinder sind noch nicht wirklich eingebunden in die Welt mit ihren Pflichten und Verantwortungen. Sie haben ihren Freiraum, aber über die wirklich wichtigen Dinge dürfen sie nicht mitentscheiden. Und oft genug heißt es „Das verstehst du noch nicht“ oder „Dafür bist du noch zu jung.
Wer also möchte wirklich ein Narr sein? An den tollen Tagen im Februar, wenn sie das Rathaus stürmen oder ihre Kappensitzungen durchführen, nun gut, dann lässt es sich mancher gern gefallen, ein Narr genannt zu werden. In der fünften Jahreszeit nimmt man es nicht so genau, aber wehe es nennt uns einer in den übrigen vier Jahreszeiten einen Narren.
Das hieße ja, man wüsste nicht wirklich Bescheid. Oder schlimmer noch, man gehörte nicht dazu.
II
Soll ich wirklich? Was sagt das nun über mich selbst, wenn ich über den Narren schreibe und so womöglich kundtue, wes Geistes Kind ich bin?
Aber nun gut. Retten wir uns ganz schnell, indem wir darauf verweisen, dass der Narr ja auch eine literarische Figur ist. Und dass es genügend Pfarrer gibt, die einmal im Jahr auf die Kanzel steigen und ihrer Gemeinde eine Narrenrede halten. Und schließlich ist ja auch der Apostel Paulus einmal ins bunte Gewand geschlüpft und hat… na, Sie wissen schon.
Ja, ganz richtig. Um den wird es auch gehen. Der Apostel Paulus ist für einen Essay über den Narren keine uninteressante Gestalt. Und einem Theologen gebührte es eigentlich, mit ihm anzufangen. Aber ausnahmsweise möchte ich es einmal anders halten. Nicht mit dem Apostel Paulus möchte ich anfangen, sondern mit William Shakespeare. Weil von ihm., aber das klä¬ ren wir später.
Aber nun zu Shakespeare.
III
Narren treten bei Shakespeare häufig auf. Und das ist womöglich auch nicht verwunderlich. Denn Komödie und Tragödie, das geht bei ihm kunterbunt durcheinander. Eine Komödie wie „Der Kaufmann von Venedig“ oder „Maß für Maß“ (wenn das denn eine Komödie ist) haben einen fast tragischen Emst, während es in den Tragödien wie „Hamlet“ oder „König Lear“ burleske und geradezu groteske Szenen gibt. Die beiden Totengräber im 5. Akt des „Hamlet“, die das Grab für die tote Ophelia schaufeln, reden wie Gelehrte, ohne deren Sprache wirklich zu beherrschen. Sie machen derbe Witze über den Tod und sind doch zugleich Philosophen, die einen tiefen Einblick in das Wesen der Welt gewähren. Und so sagen sie, was sonst keiner sagen dürfte: dass nämlich Ophelia, die ins Wasser ging, nur deshalb in geweihter Erde liegen darf, weil sie die Tochter eines mächtigen Mannes war.
Eine weitere Gestalt, über die man beim Thema des Narren bei Shakespeare nachsinnen könnte, ist Hamlet selbst. Bekanntlich gibt der Dänenprinz sich im Verlauf des Stücks mehr und mehr als wahnsinnig. Aber wenn es die Funktion des Narren ist, die Wahrheit ans Licht zu bringen, dann ist Hamlet keiner. Dass er den Wahnsinnigen spielt, hat den Sinn, ihn selbst und die furchtbare Wahrheit, dass die Mutter und deren neuer Ehemann Hamlets Vater umgebracht haben, zu verbergen und zugleich Zeit zu gewinnen, einen Racheplan zu schmieden. Am wichtigsten für mein Thema scheint mir aber eine andere Figur. Es ist die des Narren im „König Lear“. Am Anfang des Stücks will König Lear sein Reich unter seinen Töchtern aufteilen. Die drei Töchter sollen ihm sagen, wie sehr sie ihren Vater lieben. Goneril und Regan, die beiden älteren, halten blumige Reden, aber Cordelia schweigt und wird dafür vom Vater verstoßen. Der Anteil an der Macht, den sie erhalten sollte, wird unter die anderen beiden Töchter aufgeteilt und der Herzog von Kent, der sich für Cordelia einsetzt, wird von Lear für vogelffei erklärt. Natürlich ahnt der Leser dieses Stückes, dass dies nicht gut gehen kann, aber es ist der Hofnarr, den der König sich zur eigenen Belustigung hält, der die Wahrheit ausspricht, und zwar gleich bei seinem ersten Auftritt:
Narr: (zu Kent): Höre Freund, du tätst am besten, meine Kappe zu nehmen.
Kent: Warum, mein Kind?
Narr: Warum? Weil du’s mit einem hältst, der in Ungnade gefallen ist. Ja, wenn du nicht lächeln kannst, je nachdem der Wind kommt, so wirst du bald einen Schnupfen weghaben. Da, nimm meine Kappe. Sieh, dieser Mensch da hat zwei von seinen Töchtern verbannt, und der dritten wider Willen seinen Segen gegeben; wenn du dem folgen willst, musst du notwendig meine Kappe tragen. Nun, wie steht’s, Gevatter? Ich wollt ich hätte zwei Kappen und zwei Töchter! –
Lear: Warum, mein Söhnchen?
Narr: Wenn ich ihnen all meine Habe geschenkt hätte; die Kappen behielt ich für mich; ich habe meine; bettle du dir eine zweite von deinen Töchtern.
Lear: Nimm dich in Acht, du! -Die Peitsche! –
Narr: Wahrheit ist ein Hund, der ins Loch muss und hinausgepeitscht wird, während Madame Schoßhündin am Feuer stehen und stinken darf
…
Lear: Ein bittrer Narr!
Narr: Weißt du den Unterschied, mein Junge, zwischen einem bittren Narren und einem süßen Narren?
Lear: Nein, Bursch, lehr ihn mich.
Narr: Der dir ’s geraten, Lear,
Dein Land zu geben hin.
Den stell hierher zu mir
Oder stehe du für ihn.
Der süß und bittre Narr
Zeigt sich dir nun sofort.
Der ein im scheckgen Wams
Den andren siehst du dort.
Lear: Nennst du mich Narr, Junge?
Narr: Alle deine andren Titel hast du weggeschenkt; mit dem bist du geboren.
(William Shakespeare „König Lear“, Erster Aufzug, Vierte Szene)
IV
In einer verrückten Welt ist es der Narr, der die Wahrheit sagt. Sie manchmal förmlich herausschreit. Und zwar denen in die Ohren, die sie am wenigsten hören wollen. Das ist der tiefe Sinn des Narren, und die meisten Auftritte im Karneval, die man so erlebt, sind nur ein billiger Abklatsch. Die Wahrheit des Narren ist unangenehm, und deshalb trägt der Narr ja auch sein buntes Gewand.
Aber womöglich ist der Narr ja auch ein Mensch, der ausreitet wie Don Quixote um die Welt zu verändern. Bzw. die Welt zu finden, die er sucht. Don Quixote sucht eine Welt, die verschwunden ist, die nur noch in den (Schund)romanen existiert, die er gelesen hat und der deshalb eine Bauemmagd für Dulzinea hält und Windmühlen für Riesen.
Natürlich kann man sagen, Don Quixote sei etwas wirr im Kopf Natürlich könnte man ihn einsperren und mit Medikamenten behandeln. Aber warum sollte man nicht auch behaupten können, dieser Narr begebe sich auf die Suche nach einer besseren Welt, die vorerst nur in seinem Kopf existiert?
V
Die Suche nach einer anderen, einer menschlicheren Welt. Sie ist vermutlich das geheime Ziel des Narren. Und damit bin ich nun bei Jesus von Nazareth angelangt. Womöglich werde ich dafür demnächst der Ketzerei beschuldigt, aber den Versuch, den Mann aus Nazareth unter diesem Blickwinkel zu sehen, dürfte es wohl wert sein.
Da tritt also einer in einem von den Römern besetzten, von tiefen Spannungen zerrissenen Land auf und verkündet, die Herrschaft Gottes sei nahe herbeigekommen. Und trifft dabei auf eine tiefe Sehnsucht der Mensehen. Ob er nicht weiß, was er mit seiner Predigt anrichtet, das jüdische Gesetz sei von Menschen gemacht und deshalb nicht unfehlbar? Ob er nicht begreift, was er anrichtet, wenn er Menschen am Sabbat heilt und damit eine der heiligsten Vorschriften übertritt?
Eugen Drewermann aber auch andere wie John Dominic Crossan haben in ihren Büchern gezeigt, wie sehr der Mann aus Nazareth die bestehende Ordnung in Frage stellte. Dabei war er ganz bestimmt kein Revolutionär. Nichts verabscheute er mehr als die Gewalt; das zeigen seine Worte in der Bergpredigt, wo es heißt: „Du sollst nicht widerstreben dem Bösen, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch noch die linke hin.“ (Matthäus, Kapitel 5)
Ist Jesus also ein Narr? Wenn man das Wort nicht in einem verächtlichen Sinn gebraucht, könnte man ihn tatsächlich so nennen. Der Narr nimmt keine Rücksicht darauf, was die Leute hören wollen. Und ebenso wenig nimmt er Rücksicht darauf, was sie über ihn denken. Er glaubt an eine Welt, in der die Wahrheit regiert. Womöglich nimmt er sogar eine bessere Welt vorweg. Don Quixote ritt los, um die Welt der Ritter zu suchen. Jesus zog durch das von den Römern beherrschte und von religiösen Spannungen geschüttelte Palästina, um den Menschen von der gewaltlosen Herrschaft Gottes zu erzählen, in der die Trauernden getröstet werden und die Friedensstifter Gottes Kinder heißen. Er glaubt so sehr an sie, dass sie ihm schon jetzt als real erscheint.
Wenn Jesus also davon überzeugt ist, dass das Vertrauen zu Gottes Liebe auch die größte Feindschaft überwinden kann, dass Vergebung die Menschen zu anderen macht als sie sind und die Ordnungen um der Menschen willen da sind, dann läuft er ein ungeheures Risiko. Und nicht nur das: Auch andere setzt er diesem Risiko auf. Kann man wirklich darauf verzichten, sich vor dem anderen zu schützen, wie Jesus es in der Bergpredigt fordert? Soll man wirklich aufhören für die Zukunft zu sorgen und ganz dem heutigen Tag leben? Soll man auf Besitz verzichten, wie Jesus, von der Hand in den Mund leben, wie er, am Morgen nicht wissen, wo man am Abend schlafen soll? Allein die Lebensweise dieses Marmes ist ja schon eine Provokation, und dass er andere – z.B. den reichen Jüngling – auffordert, ebenso zu leben, ist erst recht eine. Wie viele Schwierigkeiten eine verfasste Kirche mit diesem Text im Lauf der Jahrhunderte gehabt hat – allein das wäre schon eine Untersuchung wert. So vieles, was er in Frage stellt, weil darin die Nähe Gottes verdunkelt wird, weil Menschen unfrei gemacht werden, weil sie für immer an eine Vergangenheit gekettet werden, die sie knechtet. Ich denke, es ist ihm bewusst gewesen, wie sehr er sich in den Gegensatz zur bestehenden Ordnung stellte. Und auch, welche Gefahr er lief und doch geht er sehenden Auges in sie hinein, im Vertrauen auf den Gott, der ihm hilft. Selbst als es klar wird, dass seine Feinde seinen Tod planen, zieht er sich nicht zurück ins rettende Ausland, sondern er stellt sich der Konfrontation, in der er nur verlieren kann. Stellt sich, weil er anders die Wahrheit seines Lebens nicht behalten könnte. Und weil er wahrscheinlich trotz aller Bedrängnis daran glaubte, dass das Reich Gottes bald anbrechen würde. Ob er glaubte, dass er es mit seinem Tod beschleunigen könnte? Wir wissen es nicht.
So weit ist das alles noch vom Verstand her zu begreifen. Und zu begreifen ist ebenfalls wie viel Mühe die Theologen aufwenden mussten, um aus diesem Radikalen einen zu machen, der in eine bürgerliche Kirche passte. Ob er am Ende doch noch gesiegt hat; vielmehr ob Gott diese Niederlage in einen Sieg verwandelt hat, indem er Jesus von den Toten auferweckte und sich so zu ihm bekannte, das ist eine Frage, die nicht mehr vom Verstand, sondern nur noch vom Glauben her zu beantworten ist.
VI
Hier muss sich wohl nun fast zwangsläufig das Kapitel über den Apostel Paulus anschließen. Auch wenn Paulus, als der erste und wohl auch bedeutendste Theologe der Christenheit viele Linien des historischen Jesus hat abbrechen lassen, indem er ihn auf Kreuz und Auferstehung reduzierte und von seinem Leben nichts wissen wollte; in seiner Paradoxie und seiner Radikalität hat er Jesus sehr wohl verstanden. Und in den Narrenkapiteln des Ersten und Zweiten Korintherbriefs hat er das Wesentliche des Mannes aus Nazareth geradezu auf den Punkt gebracht. Wahrscheinlich ist es ja nicht zufällig, dass Paulus genau an dieser Stelle mit der Ge¬ meinde in Korinth in Streit gerät. Die Gemeinde in Korinth oder besser gesagt, eine ihrer Gruppierungen, beruft sich auf esoterische „Weisheit“ (eine Art Geheimphilosophie) von der sie glaubt, diese Weisheit erhebe sie über andere Christen. Paulus, dessen Ausgangspunkt die Rechtfertigung allein aus Gottes Gnade ist, kann das natürlich nicht so stehen lassen. Und so stellt er der Weisheit der Korinther in Erste Korinther 1,18ff die „göttliche Torheit“ entgegen. „Weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt zu retten, die daran glauben“, so schreibt er in 1. Korinther 1,21 und fährt fort: „Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein ^gemis und den Griechen eine Tor¬ heit; denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen predigen wir Christus als göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind.“(l.Kor 1,22-25)
Paulus zieht hier die Konsequenz aus Tod und Auferstehung Jesu und im Grunde auch aus der gesamten Verkündigung Jesu. Jesus hatte auf die Liebe und das Vertrauen gesetzt, gegen Angst und Gewalt, und hatte sich damit – menschlich gesehen – zum Narren gemacht. Wenn es aber stimmt, dass Gott sich mit diesem „Narren“ identifiziert hat, dann muss man – so Paulus, völlig konsequent, wie ich meine – auch auf die Narrheit setzen. Und darauf hoffen, dass am Ende tatsächlich das Schwache das Starke überwinde.
VII
Eigentlich – so sollte man meinen – eigentlich ist dieses Paradox nicht mehr zu überbieten. Die göttliche Torheit, die weiser ist als die Menschen sind und die göttliche Schwäche, die stärker ist als die Menschen sind – da ist tatsächlich der Sprung in den Glauben gefordert, von dem Kierkegaard spricht. Aber wenn man sich dann mit Friedrich Dürrenmatt beschäftigt, stellt man fest, dass es diesem Schweizer Schriftsteller tatsächlich gelungen ist, dieses Paradox noch einmal auf die Spitze zu treiben.
Nun ist es natürlich kein Zufall, dass ich mich im Rahmen dieses Essays über den Narren mit Friedrich Dürrenmatt beschäftige. In Dürrenmatt Stücken treten immer wieder Narren auf, auch wenn sie nicht so heißen. Sie verkörpern das Gute in einer katastrophal bösen Welt. In seinen Stücken hat Friedrich Dürrenmatt sich mit überraschender Konsequenz an seine Maxime gehalten, „eine Geschichte sei damit zu Ende gedacht, wenn sie die schlimmstmögliche Wendung nehme.“ (Hugo Loetscher „Ein Gedankendramaturg“ in „Über Friedrich Dürrenmatt“, Zürich 19863) Dürrenmatts Stücke sind wahrhaftig nichts für schwache Nerven. Nicht nur, dass sie scheinbar keine Moral haben, dass also das Böse siegt und das Gute unterliegt. Nein, Dürrenmatt schaut auch aus einer eisigen Höhe auf seine Figuren. Ähnlich wie Brecht in seinem epischen Theater lässt er dem Zuschauer keine Möglichkeit, sich mit irgendeiner Figur zu identifizieren. Entweder sind sie abgrundtief böse, wie Claire Zachanassian, die Milliardärin aus „Der Besuch der alten Dame“, die den Bürgern der Kleinstadt Güllen – ihren ehemaligen Bekannten und Schulkameraden, deren Welt sie längst entwachsen ist – eine Milliarde bietet, wenn sie ihren früheren Liebhaber Ill umbringen, oder sie sind kalt und überdies Betrüger, wie Florestan Mississippi, der Staatsanwalt, der die Todesstrafe für Ehebruch wieder einführen will und schließlich von einem früheren Komplizen als ehemaliger Zuhälter entlarvt wird. Diese Stücke sind Versuchsanordnungen, nur dass es hier nicht um chemische Verbindungen geht, sondern um Menschen. Falls an dieser Stelle jemand das Wort „Freiheit“ murmeln sollte, empfehle ich ihm, erst einmal Dürrenmatts Theaterstücke zu lesen. Nichts und niemand entkommt dem Dürrenmattschen Gericht, das man getrost als „Jüngstes Gericht“ bezeichnen darf. Wobei man sich manchmal fragt, was nun schwerer wiegt, der Ernst oder das Lachen, das in diesen Stücken immer wieder hörbar wird. Dürrenmatts Gelächter verschont nichts und niemand. Man könnte das Stück für Stück durchexerzieren, aber ich will meine These nur mit seinem ersten Theaterstück „Es steht geschrieben“ belegen. Das Stück erzählt von der bigotten Herrschaft der Wiedertäufer und der Wiedereinnahme von Münster durch die Truppen des (evangelischen) Landgrafen von Hessen und des Bischofs von Münster, und es endet mit der furchtbaren Rache, die der Bischof nimmt. „Es steht geschrieben“ gibt sie alle dem großen Gelächter preis – gleich, ob sie nun reich oder arm, einfach oder mächtig, Katholiken, Lutheraner oder Wiedertäufer sind. Der Kaiser: ein Schwachkopf. Der Landgraf von Hessen: ein Bigamist. Jan Bockelson, der Führer der Wiedertäufer: ein Mann, der nach Reichtum und Lebensgenuss giert, obwohl er das genaue Gegenteil predigt. Dieses Stück ist ebenso tragisch wie komisch, und man kann es durchaus als Frage auffassen, wo in dieser schrecklichen Welt Gott denn zu finden sei.
Und doch gibt es Menschen, die merkwürdig unberührt durch die Dürrenmattsche Hölle gehen. Nicht, dass sie nicht verletzbar sind. Das meine ich nicht. Sie tragen ihre Narben davon wie alle anderen auch, und womöglich sterben sie auch an ihren Verletzungen. So wie Knipperdollinck, der reiche Mann, der der Predigt des Wiedertäufers Bockelson gefolgt ist und sein Vermögen an die Armen der Stadt verschenkt hat. Der reiche Jüngling aus der biblischen Geschichte ist die Folie, von der Knipperdollinck sich abheben will, und weil das so ist, gibt er alles her; nicht nur seinen Besitz, sondern auch Frau und Tochter. Knipperdollinck ist die einzige sympathische und vor allem glaubwürdige Gestalt in diesem Stück. Aber zugleich ist dieser Mann – genau wie auch andere Figuren aus Dürrenmatts Komödien (eine merkwürdige Bezeichnung für Stücke von so tiefem Ernst) ein Narr reinsten Wassers. „Reiner Tor“ wäre wohl die angemessenste Bezeichnung für ihn. Erbe greift einfach nicht, dass Bockelson und die anderen Führer der Wiedertäufer Heuchler sind, die anderen Askese predigen und selbst im Luxus leben. Knipperdollinck sucht den Weg zu Gott – und endet aufs Rad geflochten. Dürrenmatt hat ihm in seinem Stück das letzte Wort gegeben:
Knipperdollinck: Herr! Herr!
Sieh mich Dir an diesem Rad entgegengebreitet!
Sieh meinen Leib, der zerbrochen ist, und meine Glieder,
die in dieses Holz gespannt sind,
das mich umgibt als meine Grenze, die Du mir gesetzt hast,
damit ich mich selbst erkenne!
Ich habe alles von mir geworfen, als wäre es Feuer in meinen
Händen, und Du hast keine meiner Gaben verschmäht.
Herr! Herr!
Nun breitest Du Dein Schweigen über mich, und die Kälte
Deines Himmels tauchst Du in mein Herz wie ein Schwert!
Senkrecht steigt meine Verzweiflung zu Dir, eine lodernde
Flamme,
und die Qual, die mich zerfleischt,
und der Schrei meines Mundes, der sich Dir entgegenwirft,
und der nun zu Deinem Lobe verklingt,
denn alles, was geschieht, offenbart Deine Unendlichkeit,
Herr!
Die Tiefe meiner Verzweiflung ist nur ein Gleichnis Deiner
Gerechtigkeit,
und wie in einer Schale liegt mein Leib in diesem Rad, welches
Du jetzt mit Deiner Gnade bis zum Rande füllst!
(Friedrich Dürrenmatt; Werkausgabe in dreißig Bänden, Band 1, Frühe Stücke, Zürich 1985, Seite 147f.)
Mit diesen Worten endet das Stück, und man kann fragen, wie ernst ein Stückeschreiber sie meint, der ansonsten nichts und niemand mit seinem kalten Flohn verschont. Und doch erinnern mich diese Worte an den am Kreuz sterbenden Jesus. Wenn die Evangelisten etwas mehr Kunst für ihre Darstellung aufgewendet hätten, dann hätten sie Jesus womöglich so sprechen lassen können.
Was mich in diesem Zusammenhang nicht wenig beunruhigt, ist die Tatsache, dass die Narren die Welt nicht verändern. Jedenfalls bei Dürrenmatt tun sie es nicht. Der hochherzige aber sich um seinen Verstand saufende Graf Übelohe-Zabernsee in „Die Ehe des Herrn Mississippi“ rettet Anastasia nicht. Das Mädchen, das unbeirrt den Bettler liebt, dem es vom Engel zuerst geschenkt wurde, weil seine Bestimmung war, den ärmsten der Menschen zu lieben, hält an dieser Bestimmung fest, obwohl dieser Bettler sich als reichster und mächtigster Mann Babylons entpuppt. Aber auch das hält den Lauf der Welt nicht auf; im Gegenteil: Weil das Mädchen nicht den König lieben will, sondern nur den Bettler, in dessen Gestalt er sich ihr zuerst gezeigt hat, will Nebukadnezar schließlich den Himmel stürmen und lässt zu diesem Zweck den Turm von Babylon bauen. („Ein Engel kommt nach Babylon“). Das heißt, die Gedanken Gottes, die auf das Gute gerichtet sind, verkehren sich ins Böse, und zumindest in diesem Stück ist noch sehr die Frage, wer dafür verantwortlich ist: Gott oder die Menschen. Vermutlich ist auch Ill im „Besuch der Alten Dame“, ein Narr, der schließlich seinen Tod auf sich nimmt, obwohl er ja auch fliehen könnte. Sie alle passen nicht in die Welt der Heuchler, Geschäftemacher und der skrupellosen Ideologen. Sie kommen alle unter die Räder. Ausnahmslos.
Der Narr der schon bei Shakespeare derjenige war, der allein um die Wahrheit wusste, der dem König die Wahrheit sagte, auch wenn sie unangenehm war, der Narr ist die tiefste aller Dürrenmattschen Gestalten. Und in ihr verbirgt Dürrenmatt auch seine eigene Wahrheit. Graf Übelohe sagt es so: „Oh, ich will es ihm (dem Autor, B.G.) glauben, daß er mich nicht leichtfertig schuf, irgendeiner zufälligen Liebesstunde verfallen, sondern daß es ihm darum ging, zu untersuchen, was sich beim Zusammenprall bestimmter Ideen mit Menschen ereignet, die diese Ideen wirklich ernst nehmen und mit kühner Energie, mit rasender Tollheit und mit einer unerschöpflichen Gier nach Vollkommenheit zu verwirklichen trachten, ich will ihm das glauben. Und auch dies, daß es dem neugierigen Autor auf die Frage ankam, ob der Geist – in irgendeiner Form – imstande sei, eine Welt zu ändern, die nur existiert, die keine Idee besitzt, ob die Welt als Stoff unverbesserlich sei; einem Verdacht nachzuspüren, der in ihm in einer verlorenen Nacht vielleicht einmal aufstieg: Auch dies will ich ihm glauben; doch daß er dann, wie er uns geschaffen hatte, nicht mehr in unser Schicksal eingriff, das, meine Damen und Herren, bleibt bitter zu beklagen. So schuf er denn auch mich, den Grafen Bodo von Übelohe-Zabernsee, den einzigen, den er mit ganzer Leidenschaft liebte, weil ich allein in diesem Stück das Abenteuer der Liebe auf mich nehme… So ließ der Liebhaber grausamer Fabeln und nichtsnutziger Lustspiele, der mich schuf, dieser zähschreibende Protestant und verlorene Phantast mich zerbrechen, um meinen Kern zu schmecken – o schreckliche Neugierde -; so entwürdigte er mich, um mich einem Heiligen ähnlich – der ihm nichts nützt -, sondern ihm selbst gleichzumachen, um mich nicht als Sieger, sondern als Besiegten – die einzige Position, in die der Mensch immer wieder kommt in den Tiegel seiner Komödie zu werfen:
Dies allein nur, um zu sehen, ob denn wirklich Gottes Gnade in dieser endlichen Schöpfung unendlich sei, unsere einzige Hoffnung.“ (Die Ehe des Herrn Mississippi“, S.57f.)
Merkwürdig, nicht wahr? Da benutzt einer, den manche als abgrundtiefen Pessimisten und andere als Zyniker beschreiben, Worte, mit denen man auch eine Christusfigur beschreiben könnte. Natürlich sind diese Worte wiederum ironisiert, indem da eine Figur gleichsam aus dem Stück heraustritt und über ihren Schöpfer nachsinnt, aber bei aller Gebrochenheit könnte dies dennoch das Glaubensbekenntnis des Dichters Friedrich Dürrenmatt sein. Ein Glaubensbekenntnis, das doch sehr an Paulus erinnert und an seinen Satz: „Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark.“ii
____________________
i Erstveröffentlichung in „Deutsches Pfarrerblatt“ 2/2004
ii Wen das Thema noch weiter interessiert, den verweise ich auf mein Buch „Die fremde Botschaft. Annäherung an den christlichen Glauben (Persimplex Verlag, Wismar 2013) Dort habe ich die hier angerissenen Themen in verschiedenen Kapiteln noch einmal weiterverfolgt.